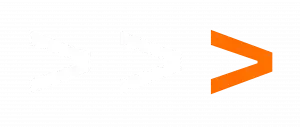
Unternehmen können Künstliche Intelligenz auf vielfältige Weise einsetzen, vom virtuellen Assistenten über Prognosetools bis zu selbstständig handelnden Systemen. Die Anwendungsfälle reichen von der Unterstützung einzelner Arbeitsschritte bis zur vollständigen Automatisierung ganzer Abläufe. Studien zeigen, dass das größte Potenzial aktuell in Sales, Marketing und Produktentwicklung liegt.
Horizontale Use Cases
Abteilungsübergreifend: Infos suchen, Dokumente erstellen, Meetings zusammenfassen, Standardprozesse wie Onboarding oder Lohnabrechnung, Copilot für Office.
Vertikale Use Cases
Branchenspezifisch: Kampagnen im FMCG-Marketing, Angebotskonfiguration im Maschinenbau, Content Marketing, Logistikoptimierung, Sales Training.
Viele verwechseln klassische Machine-Learning-Modelle (ML) mit den neuen Generative-AI-Ansätzen (GenAI). Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) erkennen Muster in Zahlen, Tabellen und großen Datenmengen – perfekt für Prognosen, Statistiken oder Vorhersagen.
Generative AI (GenAI) funktioniert völlig anders: Es nutzt unstrukturierte Inhalte wie Texte, Bilder oder PDFs, denkt im Kontext und erzeugt Antworten, Automatisierungen und Prozesse, die sich direkt in den Geschäftsalltag einfügen.
Wer das durcheinanderwirft, läuft Gefahr, völlig falsche Erwartungen an die Technologie zu haben – und übersieht, dass Generative AI (GenAI) nicht „ein besseres Machine Learning“ ist, sondern eine neue Dimension von Intelligenz.
Einfach auf die einzelnen Schritte der Begriffe klicken und mehr erfahren.
Künstliche Intelligenz beschreibt Systeme, die Aufgaben übernehmen, die normalerweise menschliches Denken erfordern. Dazu gehören das Erkennen von Mustern, das Treffen von Entscheidungen oder das Lösen komplexer Probleme. Für Unternehmen ist AI ein Werkzeug, um Prozesse schneller, effizienter und intelligenter zu gestalten.
Das sind Systeme, die eigenständig Aufgaben ausführen können, zum Beispiel Daten abfragen, Entscheidungen vorbereiten oder Workflows starten. Sie entlasten Mitarbeiter und sorgen dafür, dass Routineaufgaben automatisiert ablaufen.
Es geht darum, KI so einzusetzen, dass sie fair, nachvollziehbar und verantwortungsvoll bleibt. Für CEOs bedeutet das: Reputationsrisiken vermeiden und Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern sichern.
Hierunter versteht man Regeln und Prozesse, die den sicheren und rechtmäßigen Einsatz von KI steuern. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf Datenschutz, regulatorische Anforderungen und Unternehmensrisiken.
KI-Systeme müssen vor Manipulation und Angriffen geschützt werden, sonst können falsche Entscheidungen oder Datenmissbrauch entstehen. Sicherheit ist deshalb eine Grundvoraussetzung für den produktiven Einsatz.
Bias bedeutet, dass KI Vorurteile übernimmt und dadurch verzerrte Ergebnisse liefert, zum Beispiel bei Bewerbungen oder Kreditvergaben. Für Unternehmen ist es entscheidend, Bias zu erkennen und aktiv zu vermeiden.
Beschreibt die Frage, wo Daten liegen und wer die Kontrolle darüber hat. Gerade bei internationalen Cloud-Anbietern müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie die gesetzlichen Vorgaben und Compliance-Anforderungen einhalten.
Ein Teilbereich von Machine Learning, bei dem große neuronale Netze genutzt werden, um Sprache, Bilder oder komplexe Muster zu erkennen. Es ist die Grundlage vieler moderner Anwendungen, wie Sprachassistenten oder Bilderkennung.
KI muss erklärbar sein, damit Unternehmen und Kunden verstehen, warum ein Ergebnis zustande gekommen ist. Ohne Erklärbarkeit sinkt das Vertrauen und steigt das Risiko von Fehlentscheidungen.
GenAI kann neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Code erzeugen und arbeitet vor allem mit unstrukturierten Daten. Der Vorteil für Unternehmen: Prozesse lassen sich kontextbezogen automatisieren und die Interaktion mit Wissen wird neu möglich.
So nennt man es, wenn eine KI Antworten erfindet oder falsche Informationen ausgibt. Für Unternehmen ist wichtig: Diese Risiken lassen sich steuern, indem man eigene Datenquellen richtig einbindet.
Maschinelles Lernen erkennt Muster in strukturierten Daten wie Zahlen oder Tabellen und macht Vorhersagen. Typische Beispiele sind Absatzprognosen, Wartungszyklen oder Risikoanalysen.
Wenn sich Daten oder Umgebungen ändern, können KI-Modelle ungenau werden. Das passiert oft schleichend und erfordert Monitoring, um rechtzeitig gegenzusteuern.
Beschreibt die Fähigkeit, das Verhalten einer KI kontinuierlich zu überwachen. Für CEOs bedeutet das: Transparenz über Qualität, Performance und Risiken.
Eine Manipulation, bei der Nutzer Eingaben so formulieren, dass KI-Systeme falsche oder unerwünschte Ergebnisse liefern. Unternehmen müssen Schutzmechanismen einbauen, um Missbrauch zu verhindern.
Eine Methode, die Sprachmodelle mit einer gezielten Suche in Unternehmensdaten verbindet. So lassen sich PDFs, Präsentationen oder E-Mails präzise nutzen, ohne die Kontextgrenzen des Modells zu überschreiten.
Daten, die klar organisiert sind, zum Beispiel in Tabellen oder Datenbanken. Sie lassen sich leicht auswerten und sind die Basis für viele klassische ML-Anwendungen.
Sprache wird von KI in kleine Einheiten zerlegt, sogenannte Tokens. Je mehr Tokens verarbeitet werden können, desto besser versteht ein Modell komplexe Zusammenhänge.
Texte, Bilder, Videos oder E-Mails, die nicht in Tabellen passen. GenAI kann diese Daten nutzen und in Antworten oder Prozesse verwandeln.
Eine spezielle Datenbank, die Informationen nach Bedeutung statt nach Schlüsselwörtern durchsucht. Sie ist die Grundlage dafür, dass KI relevante Inhalte im richtigen Kontext findet.
Retrieval Augmented Generation verbindet ein Sprachmodell mit einer gezielten Suche in unstrukturierten Unternehmensdaten. Dokumente wie PDF, Word, Excel oder Bilddateien werden in kleine inhaltliche Abschnitte zerlegt und in einer Vektordatenbank gespeichert. Bei einer Anfrage durchsucht das System diese Abschnitte semantisch und fügt nur die relevantesten Inhalte in den Kontext des Modells ein. So lassen sich auch große und komplexe Dokumentbestände präzise nutzen, ohne an Kontextgrenzen des Modells zu stoßen.
Über API-Schnittstellen können strukturierte Daten aus Systemen wie Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, SAP oder anderen ERP- und CRM-Plattformen gezielt abgerufen werden. Es lassen sich einzelne Felder wie Kundenstammdaten, Opportunities, Umsätze oder Bestellstatus exakt abfragen und in Echtzeit in AI-Anwendungen einbinden. Mit Prozessen wie REROP (Read Execute Read Output Process) können diese Daten live verarbeitet und direkt für den nächsten Arbeitsschritt genutzt werden. Auch Cloud-Speicher wie OneDrive, SharePoint oder Google Drive lassen sich so anbinden.
Relationale Datenbanken wie MySQL oder PostgreSQL werden über SQL-Abfragen angebunden. Dabei werden gezielt Tabellen oder Felder abgefragt, um strukturierte Datensätze in AI-Anwendungen, Berichten oder Analysen zu verwenden. Für einfache Keyword-Suchen in klar definierten Datenfeldern ist diese Methode schnell und präzise, eignet sich jedoch nicht für unstrukturierte Inhalte.